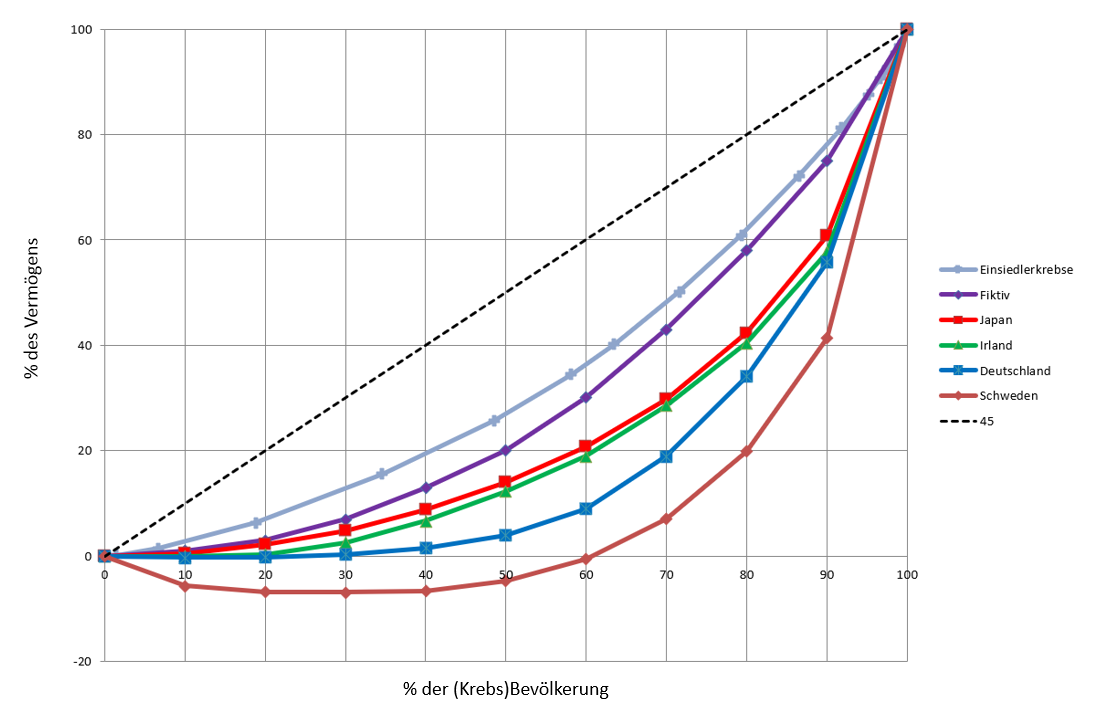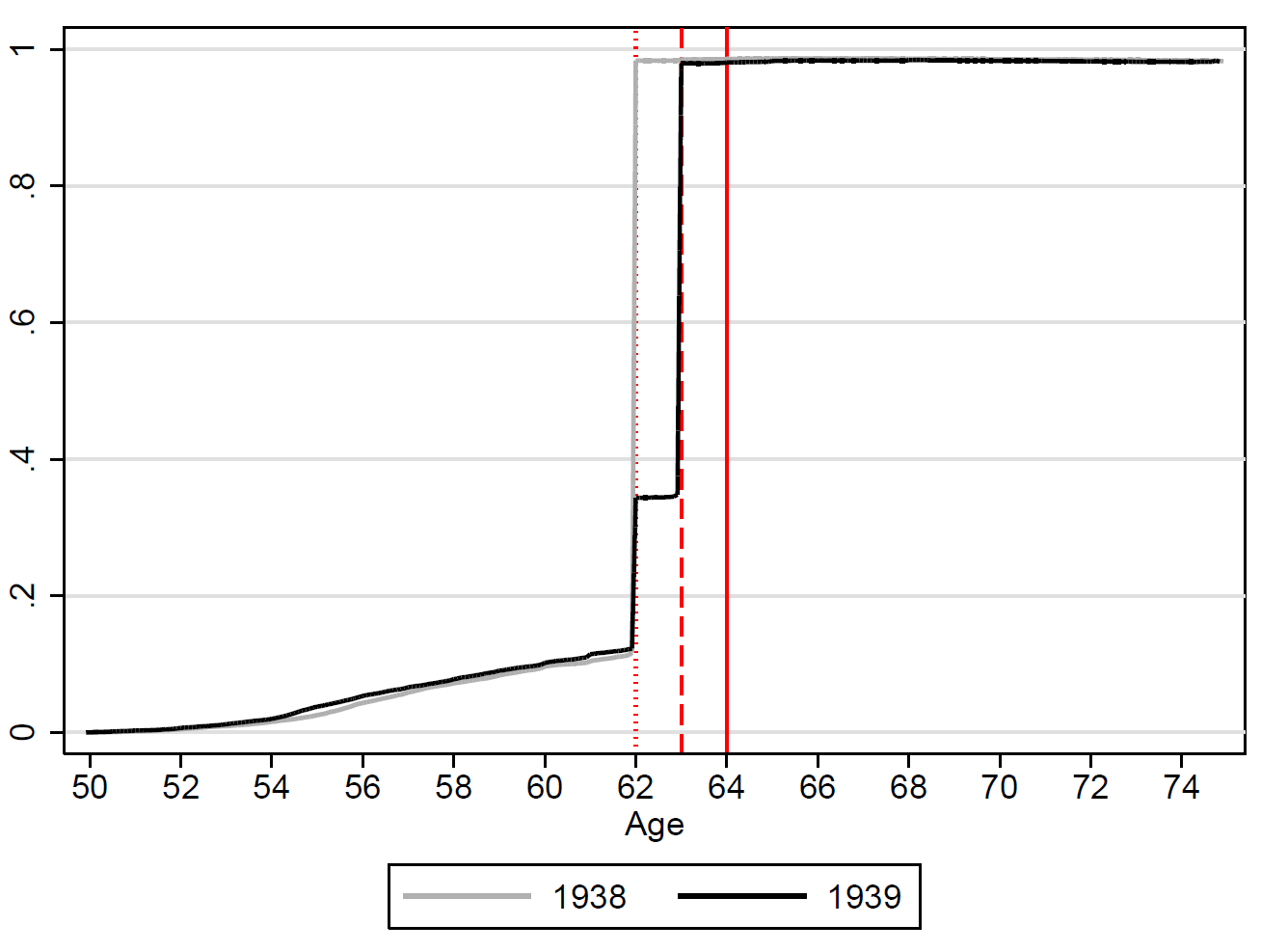[Meine Kolumne in der NZZaS vom 19. Februar 2023, ohne die kleinen Kürzungen, die notwendig waren, um die 4600 Zeichen Limite einzuhalten.]
Meine Mutter strich die Butter nicht, sie legte sie – zur Verwunderung von uns Kindern – in Zentimeter dicken Scheiben aufs Brot. Auch während zahlreicher Diätversuche zum Abnehmen und zur Senkung ihres zu hohen Cholesterolspiegels.
Der Grund: Wie viele andere Lebensmittel, war Butter von 1939 bis 1948 auch in der Schweiz rationiert. Dies alleine hätte noch nicht gereicht, Mutters nie endendes Nachholbedürfnis zu erklären. Ihre eigene, früh verwitwete Mutter war gezwungen gewesen, die Buttermarken gegen andere notwendige Güter wie Schuhe für die noch kleinen Kinder einzutauschen. Obwohl meine Mutter den Sinn von Rationierungen im Krieg durchaus einsah, fürchtete sie sich ihr ganzes Leben vor weiteren solchen Einschränkungen. Ihr späterer Butterkonsum war ihre Waffe gegen diese Angst.
Und nun: Die Rationierungsidee ist zurück als eine der Strategien zur Bewältigung des Klimawandels. Etwas versteckt wie bei der Forderung, Flugreisen nur noch für Geschäftsreisen und Familienbesuche zuzulassen. Oder sogar als Leitidee in Ulrike Herrmanns „Ende des Kapitalismus“: eine Art Kriegswirtschaft mit Kern einer Rationierung von Gütern mit CO2-Hintergrund: Privatautos und Flugreisen (keine mehr), Nahrungsmittel wie Fleisch (ein paar Gramm pro Woche), Wohnraum, eigentlich fast alle Güter.
Ganz gleich ist die Ausgangslage nicht: Ging es während der Kriege primär um eine einigermassen gerechte Zuteilung knapper lebensnotwendiger Güter, dienen die neuen Rationierungsideen dem erzwungenen Verzicht auf „schädliche“ Güter, deren Nachfrage momentan „zu hoch“ ist. Und das macht die Rationierungs-Strategie tückisch. Eine Rationierung und Ausschaltung des Preismechanismus ist das schlechteste Mittel, den Verbrauch fossiler Energien einzuschränken.
Wer festlegt, in welcher Form der CO2-Ausstoss noch erfolgen darf, tut dies unter totaler Ausblendung der individuellen Präferenzen und der menschlichen Fähigkeit, sinnlose Restriktionen zu umgehen und durch Innovationen bessere Lösungen zu finden. Und vergisst dabei die Interdependenzen zwischen den Gütern und die internationalen Verflechtungen. Das Handy wird man den Menschen kaum wegnehmen. Doch was ist dann mit Netflix?
Rationierung funktioniert prima mit den am letzten Tag einer Bergtour knapp gewordenen Lebensmitteln. Wer durch eine grössere Stadt flaniert, muss den Grössenwahnsinn einer umfassenden, der Umerziehung dienenden Rationierung sofort spüren. Selbst die geradezu einfach anmutenden Rationierungen im zweiten Weltkrieg mussten begleitet werden durch eine Vielzahl von Erlassen und ständiger Nachjustierung und Kontrollen.
Genau so wichtig: WER entscheidet, WIE die noch zugelassene Energie auf die Güter verteilt wird und zu welchem Preis diese an die Bevölkerung verteilt werden. Dies fängt schon bei den bescheidenen Formen der Rationierung an: Wer entscheidet nach welchen Kriterien, was ein genehmer, d.h. flugbegründender Familienbesuch ist? Und wer stellt sicher, dass keine zusätzlichen CO2-Schleudern (Rinder, Bitcoin-Farmen) aufgestellt werden?
Selbstverständlich spricht nichts gegen eine deutlich sparsamere Verwendung der Ressourcen – im Gegenteil: Doch der effizienteste, unbürokratischste und letztlich gerechteste Weg geht noch immer über den Preis. Zum Beispiel über eine – an die Bevölkerung zurückerstattete! – Lenkungsabgabe auf Energie in Abhängigkeit des CO2-Ausstosses. (Bitte jetzt keine Hinweise, dass die Schweiz zu klein sei, die Welt alleine zu retten; das stimmt selbstverständlich, gilt aber auch für die Rationierung.)
Die Anhängerinnen einer Rationierung scheiden diesem Mechanismus allerdings nicht zu trauen, er sei nicht wirksam. Damit argumentieren sie genau wie die Alkohol- und Tabaklobby im Widerstand gegen Lenkungsabgaben auf schädliche Substanzen. Und liegen genauso falsch. Wenn Lenkungsabgaben selbst bei Suchtmitteln funktionieren, gibt es keinen Grund anzunehmen, sie wirkten bei der Energie nicht. Wird beispielsweise der Flugpreis verdreifacht, bleibt der Flug sehr viel teuer als die Bahn, selbst wenn die ganzen Einnahmen an die Bevölkerung zurückerstattet werden.
Es ist ohnehin naiv zu glauben, Rationierung, die Mutter der Korruption, würde den Markt ausschalten. In den Kriegswirtschaften gab es Sekundärmärkte, obwohl die Regierungen versuchten, diese durch sehr aufwändige Kontrollmechanismen zu verhindern. Und blühende Schwarzmärkte sind geradezu typische Ausprägungen aller Planwirtschaften mit festgelegten Mengen und Preisen.
Das Problem dieser „Märkte“ ist, dass sie nicht mehr Angebot und Nachfrage widerspiegeln, sondern die Machtverhältnisse der Gesellschaft in unterschiedlichen Formen: Zugang zu den (klandestinen) Produzenten oder Händlern knapper Güter, die Nähe zu Beamten und zu Informationen. Wir können uns nur ausmalen, wie sehr diese Umgehungen spielen, wenn es nicht nur nicht nur um die Zuteilung knapper Güter geht wie in den Kriegen, sondern um eine obrigkeitliche Beschränkung durchaus vorhandener Güter. Darunter leiden würden diejenigen, die weder die Zeit noch das Wissen haben, in solchen Märkten mitzutun. Leiden, nicht nur unter dem künstlichen Mangel, sondern unter administrativer Demütigung.
Wie vor 80 Jahren meine Grossmutter: Mehr zugesetzt als die fehlende Butter hat meiner Mutter nämlich zeitlebens das Gefühl der Ohnmacht, Verwandten und Bekannten ausgeliefert gewesen zu sein, die die Notlage der vaterlosen Familie ausnutzten.