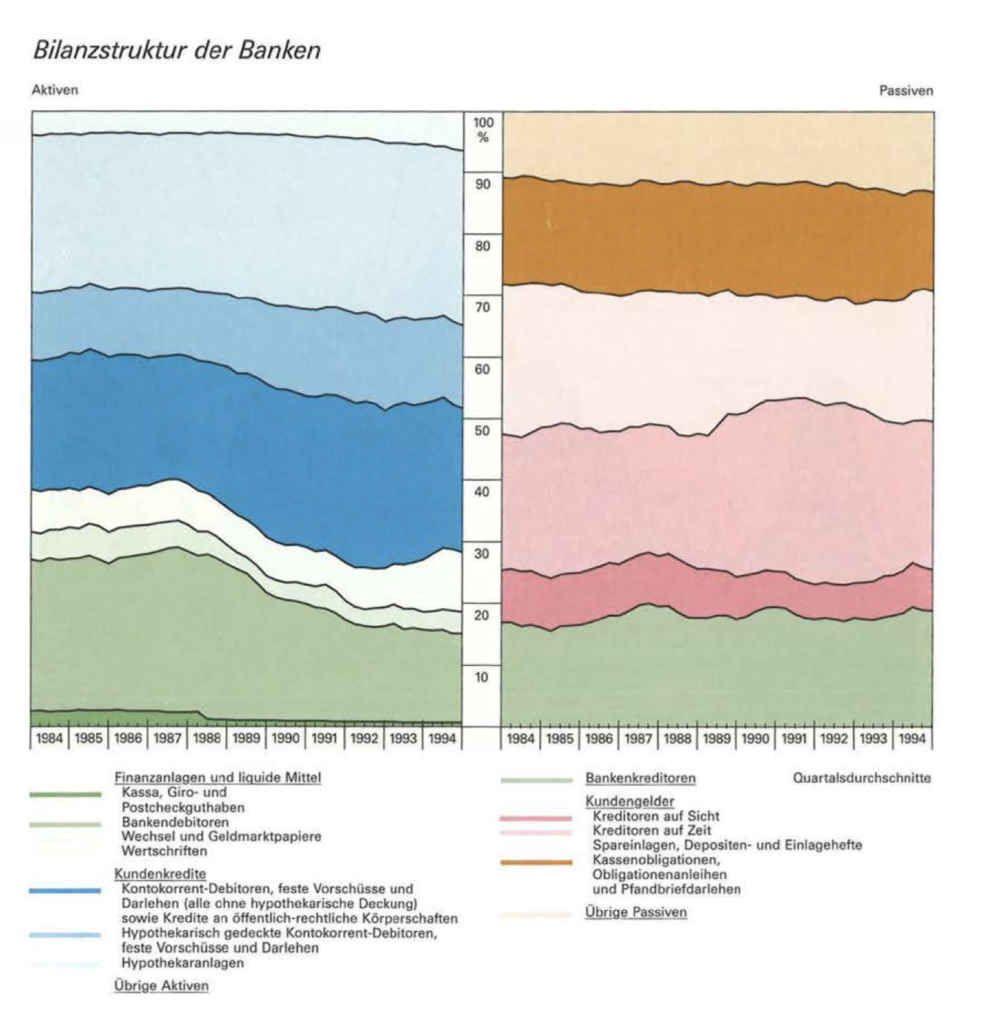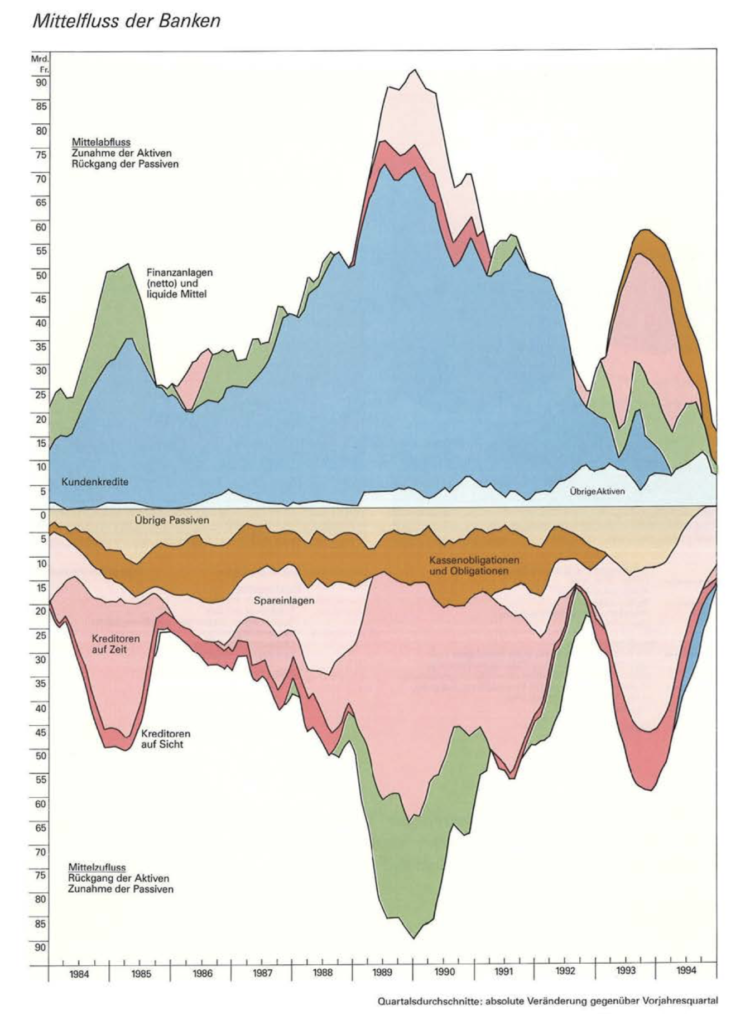Urs Birchler
Der Bundesrat “löste” das CS-Problem im vergangenen März mit Gewalt – gegenüber der Credit Suisse, der UBS und de facto gegenüber der SNB. Den vorgesehenen Instrumenten des Bankengesetzes zog er Notrecht vor. Solches erfordert starke Gründe. Die vom Bundesrat vorgebrachten Argumente hat jetzt das Financial Stability Board (FSB) in einem Bericht untersucht.
Das FSB ist das von den Behörden der G20-Länder getragene internationale Expertengremium zum Thema Finanzstabilität. Es ist das Dach-Gremium zu spezialisierteren Gremien wie dem Basler Ausschuss für Bankenaufsicht (Banken), IOSSCO (Versicherungen) u.a. Im FSB ist auch die Schweiz vertreten (aktuell mit Staatssekretärin Daniela Stoffel und Notenbankpräsident Thomas Jordan).
Das FSB als Behördenorganisation formuliert seine Berichte mit Bedacht. Auch der 35-seitige Bericht zur Behandlung der CS und anderer fallierter Banken ist sorgfältig abgefasst. Umso erstaunlicher die Aussagen: Die Kritik an der Entscheidung des Bundesrates klingt – entfernt man die übliche Watte der Diplomatie – vernichtend.
Doch vorab zum Hintergrund: Wenn eine Bank ihre Probleme nicht mehr aus eigener Kraft lösen kann, wie die CS im März 2023, gibt es im Prinzip drei Lösungen (die bei einer Aufteilung der Bank auch kombiniert werden können) :
- Modell “Götti”: Jemand (UBS, Bund) kauft die Bank samt ihren Problemen.
- Modell “Resolution”: Die Bank wird saniert.
a) mittels Rückschnitt von Ansprüchen der Aktionäre und der Gläubiger (bail in)
b) mittels Zufuhr neuer Mittel, notfalls durch den Staat (bail out) - Modell “Konkurs”: Die Bank wird liquidiert.
Der Bundesrat behauptete, das Modell Resolution – verbunden mit einer allfälligen (Teil-)Verstaatlichung sei nicht in Frage gekommen. Warum nicht?
Die zuständige Finanzministerin (frisch im Amt) liess am Wochenende der Notlösung über ihren gemäss NZZ gut informierten Parteipräsidenten im Tages-Anzeiger verlauten, der Grund sei Druck aus dem Ausland gewesen. Später argumentierte der Bund:
- Das Vertrauen in die CS sei unwiederbringlich zerstört gewesen.
- “dass eine Sanierung einer global systemrelevanten Grossbank und ein Bail-In im aktuellen Marktumfeld zu massiven Verwerfungen geführt hätte”.
- “Der Konkurs der Finanzgruppe unter Aktivierung des Schweizer Notfallplanes zur Fort- führung insbesondere der systemrelevanten Funktionen in der Schweiz hätte mit [an] Sicherheit grenzender Wahrsch[e]inlichkeit in der aktuellen Lage erst recht zu einer massiven Destabilisierung der Märkte geführt.”
Ziemlich vage verwirft das Eidg. Finanzdepartements EFD auf der FAQ-Seite zur Credit Suisse die Möglichkeit einer geordneten Resolution mit Hinweis auf internationale und nationale Risiken. Eine (Teil-)Verstaatlichung wurde offenbar nicht ernsthaft in Erwägung gezogen (und auch nicht den Kosten des TBTF-Status der Kombi-UBS gegenübergestellt), sobald am Horizont die Gotte UBS auftauchte.
Das Hauptargument des Bundesrates lautete zusammengefasst: Das vorhandene, in den vergangenen Jahren schrittweise ausgebaute, gesetzliche Instrumentarium des Modells „Resolution” war nicht anwendbar.
Schon die FINMA teilte diese Auffassung in ihrem Recovery and Resolution Report per Ende 2022 (publiziert kurz nach der CS-“Rettung”) nicht: Beide Grossbanken erhielten in allen drei Kategorien (Recovery plan, Swiss emergency plan, Institution resolvability) die Note „grün“. Dennoch sah der Bundesrat rot.
Das Financial Stability Board verwirft nun die Argumentation des Bundesrates in ihrer Gänze. Eine Umsetzung der von der FINMA – in Zusammenarbeit mit ausländischen Behörden bis hin zu asiatischen Aufsehern – vorbereiteten Resolutions-Pläne wäre möglich gewesen (S. 11). Die FINMA sei auch bereit gewesen, diese Pläne umzusetzen, sollte die Übernahme-Lösung scheitern. Im Wortlaut:
Some have suggested that … the resolution framework is not workable. However, the FSB’s review does not support that conclusion. As indicated above, a resolution was ready to be implemented that weekend. (S. 11)
Dass ein internationales Gremium dies in aller Deutlichkeit sagt, zeigt zweierlei: Erstens war der “internationale Druck” in Richtung der vom Bundesrat gewählten Lösung wohl eher eingebildet. Und zweitens sind die vom Bundesrat vorgebrachten Argumente zugunsten dieser Lösung, finanztechnisch gesprochen, Nonvaleurs. Langfristig, so sei angefügt, ziemlich teure.